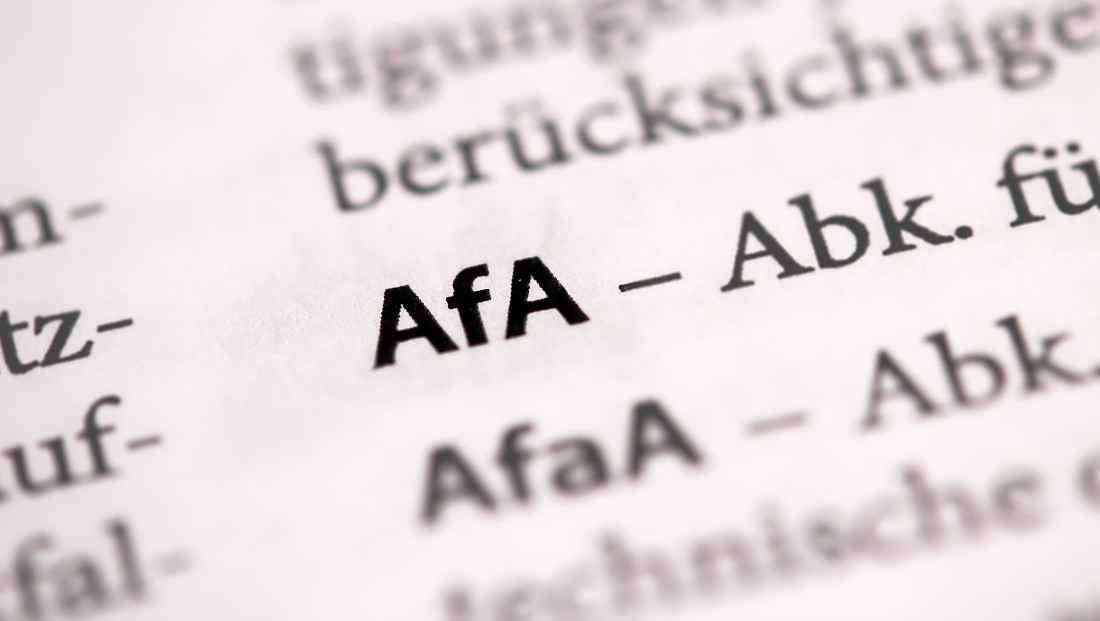Für Immobilien-Kapitalanleger – oder solche, die es werden wollen – spielt die Abschreibung einer Immobilie neben Faktoren wie Kaufpreis, Mieteinnahmen und prognostizierter Wertentwicklung eine elementare Rolle. Die sogenannte AfA – das Kürzel bedeutet „Absetzung für Abnutzung“ – wirkt sich durch steuerliche Vergünstigungen direkt auf die Rendite aus. Sie basiert auf der Annahme, dass Immobilien durch Nutzung und Gebrauch abgenutzt werden und an Wert verlieren. Dieser Wertverlust soll durch Steuervorteile quasi ausgeglichen werden. Allerdings gewährt der Gesetzgeber diese Gunst nur Eigentümern, die ihre Immobilie vermieten und daraus Einkünfte erzielen.
Lesen sie im folgenden Ratgeber, wie Sie als Vermieter von der AfA profitieren können, welche Regeln Sie beachten müssen und welche ganz legalen Möglichkeiten der AfA-Optimierung es gibt.
Was ist die AfA bei Immobilien und wer kann sie nutzen?
AfA ist die Abkürzung für „Absetzung für Abnutzung“ und wird landläufig schlicht Abschreibung genannt. Hinter dem gesamten Konstrukt steht die Überlegung, dass über eine pauschal festgesetzte Nutzungsdauer jedes Jahr ein bestimmter Prozentsatz der Investitionskosten der Anschaffung, mit der Einkünfte erwirtschaftet werden, vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden darf. Basierend auf dem Umstand, dass die Immobilie parallel mit jedem Jahr der Nutzung an Wert einbüßt. Der Gesetzgeber hat sich diese Methodik ursprünglich „ausgedacht“, um die Investitionen in Immobilien zur Vermietung zu fördern und mit steuerlichen Anreizen attraktiver zu gestalten.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum die AfA grundsätzlich nur für vermietete Immobilien greift. Selbstnutzer gehen leer aus – allerdings mit zwei Ausnahmen: Eigentümer von Denkmalschutz-Immobilien oder Immobilien, die sich in einem Sanierungsgebiet befinden, genießen besondere Abschreibungsrechte (dazu weiter unten).
Die rechtliche Grundlage für die Absetzung durch Abnutzung findet sich im Einkommensteuergesetz (EstG). Und grundsätzlich gilt: Sie dürfen ausschließlich den Wertverlust des Gebäudes zur Anrechnung bringen – in der steuerlichen Betrachtungsweise unterliegt das Grundstück keinem Wertverlust, weil es sich nicht abnutzt. Sie müssen folglich in jedem Fall eine Kaufpreisaufteilung vornehmen, den Preis für Gebäude und Grundstück also separieren, um eine Bemessungsgrundlage für die AfA zu erhalten.
Die AfA erlaubt die Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten – und startet in aller Regel mit dem Kauf der Immobilie. Sie endet, wenn Sie die Immobilie verkaufen oder das Ende des vorgesehenen Abschreibungszeitraums erreicht ist. Danach können Sie keine steuerlichen Entlastungen mehr beanspruchen. Aber: Für den neuen Eigentümer startet der Abschreibungszeitraum wieder von vorn, das heißt: er kann die AfA erneut für 40 oder 50 Jahre (je nach Art und Alter der Immobilie) geltend machen.
Gut zu wissen: Nutzen Sie eine Immobilie zunächst selbst und vermieten Sie zu einem späteren Zeitpunkt, so können Sie ab dem Vermietungstermin AfA für das Haus oder die Wohnung geltend machen. Dabei setzt das Finanzamt die verbleibende Nutzungsdauer so an, als wäre die Immobilie von Anfang an vermietet worden.
Lineare und degressive AfA
Im Grundsatz gibt es zwei reguläre Arten der Immobilien-Abschreibung – wenngleich die zweite, die degressive, eigentlich schon vor Jahren eingemottet wurde. Sie wurde für Spezialfälle nun aber reaktiviert – und wir nehmen sie deshalb der Vollständigkeit halber auch wieder mit auf.
1. Die lineare Abschreibung
Die lineare Abschreibung ist in § 7, Abs. 4 EstG geregelt und kann sowohl bei älteren wie auch neueren Immobilien genutzt werden. Sie fixiert einen konstanten Prozentsatz, der über den gesamten Abschreibungszeitraum hinweg gleichbleibt. Dabei orientiert sich die Höhe diese Satzes am Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes.
• für Immobilien bis Baujahr 1924: jährlich 2,5 % AfA, 40 Jahre lang
• Baujahr 1925 bis 2022: jährlich 2,0 % AfA, 50 Jahre lang
• Immobilien ab 2023: jährlich 3,0 % AfA, 33 Jahre lang
• Gewerbeimmobilien: jährlich 3 % AfA, 33 Jahre lang
In aller Regel unterstellt der Gesetzgeber für Wohngebäude eine Nutzungsdauer von 40 beziehungsweise 50 Jahren. Ist die tatsächliche Nutzungsdauer der Immobilie allerdings kürzer, so können Sie beim Finanzamt auch eine schnellere Abschreibung mit einem höheren Abschreibungssatz beantragen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sachverständigengutachten.
Der höhere Satz von 3 Prozent für Neubauten ab 2023 wurde noch von der Ampel-Regierung auf den Weg gebracht, um einen Investitionsanreiz für den Mietwohnungsbau zu schaffen – nachdem das selbst gesteckte Ziel von 400.000 neuen Mietwohnungen jährlich so fulminant wie kläglich verfehlt wurde.
2. Die degressive Abschreibung
Die degressive Abschreibung (§ 7, Abs. 5 EstG) wurde im Prinzip vor 20 Jahren abgeschafft. Bis 2005 konnten Eigentümer einen höheren Wertverlust in den ersten Nutzungsjahren der Immobilie geltend machen, der sich dann langsam abschwächte. So lag der Abschreibungssatz im Jahr der Fertigstellung und den folgenden neun Jahren bei 4 Prozent, in den anschließenden acht Jahren bei 2,5 Prozent, bevor für die verbleibenden 32 Jahre nur noch 1,25 Prozent steuermindernd angesetzt werden konnten. In dieser Form gilt die degressive AfA nur noch für Altfälle.
Aber: Mit der Verabschiedung des „Wachstumschancengesetzes“ im März 2024 feierte die degressive AfA ein leicht modifiziertes Comeback – und zwar rückwirkend zum 1. Oktober 2023.
Neugebaute beziehungsweise im Jahr der Fertigstellung gekaufte Wohngebäude und Wohnungen können nun nach § 7, Abs. 5a EstG im ersten Jahr mit 5 Prozent der gesamten Investitionskosten abgeschrieben werden. In den folgenden Jahren bleiben die 5 Prozent konstant, beziehen sich dann jedoch nur noch auf den abschreibungsfähigen Restwert der Immobilie. Diese neue degressive AfA gilt für Immobilien, die zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2029 gekauft wurden oder werden.
Auch die Neuauflage der degressiven AfA soll den Wohnungsbau in Deutschland in Schwung bringen und steuerliche Anziehungskraft entfalten. Ansporn obenauf: Es gibt keine Baukostenobergrenze. Sie können die Möglichkeiten der degressiven AfA daher vollumfänglich nutzen, unabhängig davon, wie hoch der Kaufpreis Ihrer neuen Immobilie ist.
3. Sonderfall: Die Denkmalschutz-AfA
Für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, gewährt der Gesetzgeber besonders hohe Steuervorteile.
• Für die Anschaffungskosten (ohne Renovierungskosten) gilt zunächst die normale lineare Abschreibung von 2 Prozent (bei Gebäuden, die ab 1925 errichtet wurden), respektive 2,5 Prozent (für Häuser, die vor 1925 gebaut wurden).
• Die Modernisierungs-, Sanierungs- und Instandhaltungskosten können Kapitalanleger zusätzlich vollständig von ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen. Und zwar 8 Jahre lang in Höhe von 9 Prozent und weitere 4 Jahre lang zu 7 Prozent. Im Saldo dürfen Sie folglich 100 Prozent der Kosten dem Fiskus „aufbürden“.
• Wichtig: Die Denkmalschutz-AfA gilt mit Abstrichen auch für Eigennutzer: Sie können 9 Prozent der Sanierungskosten über einen Zeitraum von 10 Jahren abschreiben, im Ergebnis ergo 90 Prozent der entstandenen Kosten.
Gut zu wissen: Die Regelungen der Denkmalschutz-AfA für Eigennutzer greifen in gleicher Form für Immobilien in städtebaulichen Entwicklungs- oder Sanierungsgebieten (§ 7h EstG): Selbstnutzer dürfen 10 Jahre lang jeweils 9 Prozent der Sanierungskosten absetzen.
Was kann abgeschrieben werden?
Wie bereits erwähnt, erstreckt sich die AfA nur auf das Wohngebäude, nicht aber auf das Grundstück, auf dem es steht. Vom Kaufpreis müssen Sie daher den anteiligen Wert des Grundstücks abziehen. Dieser kann recht simpel auf Basis der Bodenrichtwert-Tabelle der jeweiligen Gemeinde ermittelt werden – was jedoch nicht immer vorteilhaft sein muss, insbesondere, wenn es sich um eine Immobilie in teurer Lage oder einen kernsanierten Altbau handelt. Viele Finanzämter akzeptieren eine pauschale Kaufpreisaufteilung im Verhältnis von 80 Prozent Gebäudewert zu 20 Prozent Grundstückswert – aber halt nicht alle. Konsultieren Sie dazu unbedingt Ihren Steuerberater.
Zu den absetzbaren Ausgaben zählen insbesondere die folgenden:
• Anschaffungskosten
- Kaufpreis der Immobilie
- Notar- und Grundbuchkosten
- Maklerprovision
- Grunderwerbsteuer
- Gutachterkosten
- Fahrt- und Telefonkosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb nötig wurden
- eventuell Gerichtskosten bei Erwerb aus einer Zwangsversteigerung
Gut zu wissen: Die Kosten für die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch bleiben in dieser Liste außen vor – Sie können sie jedoch als Werbungskosten geltend machen. Beim Erwerb einer Eigentumswohnung müssen Sie überdies die anteilige Instandhaltungsrücklage von den Anschaffungskosten abziehen.
• Herstellungskosten
- Kosten für Baugenehmigung und -abnahme
- Architektenhonorar
- Handwerkerkosten
- Baumaterial
- Ausschachtungs- und Erdarbeiten
- Erstinstallationskosten für Strom, Wasser, Gas, Abwasser
- Umzäunungen, auch Hecken und Bäume
- Fahrtkosten zur Baustelle
• Anschaffungsnahe Herstellungskosten
Die Kosten für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in den ersten drei Jahren nach dem Immobilienkauf anfallen, gehören ebenfalls zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Allerdings nur, wenn der Betrag 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes (ohne Mehrwertsteuer) überschreitet.
Liegt der Betrag darunter, so zählen diese Kosten zum Erhaltungsaufwand und Sie können sie auf Basis des § 6, Abs. 1, Nr. 1a EstG als anteilige Werbungskosten sofort in Ihrer Steuererklärung abziehen. Andernfalls, also bei Überschreiten der 15-Prozent-Grenze, müssen Sie diese Ausgaben linear über 40, beziehungsweise 50 Jahre abschreiben. Nicht ganz zu Unrecht kritisieren Experten diese Regelung als „Instandhaltungsstau-Paragraphen“, weil Investoren geneigt sein könnten, notwendige Sanierungen aus Steuergründen zu verzögern.
Gut zu wissen: Laufende Modernisierungskosten, die unter die Kategorie „Erhaltungsaufwand“ fallen, dürfen Sie analog als Werbungskosten, verteilt über einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren, geltend machen. Faustformel: Setzen Sie fünf Jahre oder länger mehr als 4.000 Euro netto pro Jahr für Baumaßnahmen an, so geht das Finanzamt in aller Regel von Sanierungskosten („herstellungsnaher Aufwand“) aus – und für diese gilt dann die Abschreibung.
Sonder-AfA für neu geschaffenen Wohnraum
Wer Mietwohnungen durch Neubau, Dachaufstockung oder Dachausbau schafft, der konnte bis zum 31. Dezember 2021 zusätzlich zur Neubau-AfA von einer Sonder-AfA in Höhe von jährlich 5 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten profitieren, die über einen Zeitraum von 4 Jahren gewährt wurde. Geregelt ist sie im § 7b EstG, absetzbar sind maximal 2.000 Euro pro Quadratmeter.
Voraussetzung war außerdem, dass die Wohnungen mindestens 10 Jahre lang zu Wohnzwecken vermietet werden. Und auch hinsichtlich der Herstellungs- und Anschaffungskosten wurden Obergrenzen fixiert: Wer mehr als 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche ausgab, ging leer aus, da Luxuswohnungen nach Ansicht der Bundesregierung nicht gefördert werden müssten.
Warum wir Ihnen, diese „alten Kamellen“ hier noch einmal aufwärmen? Nun, zum 1. Januar 2023 hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen die Sonder-AfA für Mietwohnungen neu aufgelegt– allerdings mit ein paar Modifikationen:
- die 5 Prozent Abschreibung für 4 Jahre für neue Mietwohnungen dürfen Sie nur noch dann ansetzen, wenn das Gebäude den Energiestandard „Effizienzhaus 40“ erfüllt,
- dafür wurde das Limit der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf 4.800 Euro je Quadratmeter heraufgesetzt.
AfA bei Erbschaft und Schenkung
Die Abschreibung einer Mietimmobilie, die verschenkt oder vererbt wird, läuft prinzipiell schlicht und unbeeindruckt weiter – vorausgesetzt, sie wird weiter vermietet. Erbe oder Beschenkter übernehmen als Rechtsnachfolger den aktuellen Stand der Abschreibung der Immobilie und profitieren von dieser für die verbleibende Nutzungsdauer. So sehen es die Regelungen der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (§11d EstDV) vor. Wurde die Immobilie vom Verstorbenen beispielsweise bereits 25 Jahre lang abgeschrieben, so kann der Erbe dieses Procedere gelassen fortführen und – bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren – ein weiteres Vierteljahrhundert entsprechende Angaben in seiner Steuererklärung machen.
Wird die Mietimmobilie hingegen verkauft, so endet die Abschreibung für den Verkäufer, startet für den Käufer hingegen gänzlich neu, das meint: er erwirbt eine vollständige, neue Nutzungsdauer.
Am Rande: Verkaufen Sie eine vermietete Immobilie vor Ablauf der Spekulationsfrist von zehn Jahren, so haben Sie in gleich doppelter Hinsicht das Nachsehen: Zum einen müssen Sie den Gewinn aus der Veräußerung versteuern, zum andern erhöht sich dieser, weil Sie sämtliche bis dahin vorgenommenen Abschreibungen von den Anschaffungskosten abziehen müssen. Die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufspreis wird also größer – und erhöht Ihre Steuerlast.
Praktische Tipps zur AfA-Optimierung
Die Immobilien-AfA ist ihrem Wesen nach ein sehr effektives Instrument zur legalen Steueroptimierung. Sie mindert die steuerliche Bemessungsgrundlage, ohne dabei den tatsächlichen Cashflow zu belasten. Ein fundiertes Verständnis der Abschreibungsregeln und ihrer praktischen Anwendung ist daher überaus nützlich. Die folgenden Tipps leisten Schützenhilfe.
• Kaufpreisaufteilung als Kernstrategie: Sie dürfen nur den Gebäudewert abschreiben, nicht den Grund und Boden. Legen Sie diese Aufteilung bereits im Kaufvertrag fest. Eine gut begründete Aufteilung zwischen Gebäude und Grundstück muss vom Finanzamt akzeptiert werden. Je höher dabei der Gebäudeanteil ausfällt, desto „ertragreicher“ gestaltet sich Ihre Abschreibung.
• Inventar separat ausweisen: Wenn zur Immobilie hochwertige Einbauküchen, Einbauschränke oder andere nicht fest verbundene Einrichtungsgegenstände gehören, lohnt sich oft eine separate Ausweisung. Diese Gegenstände können Sie viel schneller abschreiben als das Gebäude mit seiner AfA über 50 Jahre.
Wichtig allerdings: Sprechen Sie eine geplante Inventarausweisung unbedingt zuvor mit Ihrer finanzierenden Bank ab. Das separierte Inventar dient nicht mehr als Sicherheit für Ihre Finanzierung – vermeiden Sie diesbezüglich unangenehme Probleme.
• Verkürzte Nutzungsdauer durch Gutachten: Eine unmittelbar greifende Strategie zur Optimierung Ihrer Abschreibung ist der Nachweis einer verkürzten Nutzungsdauer durch ein Sachverständigengutachten. Dieser Punkt ist vor allem für Gebäude mit Baujahr vor 2000 interessant. Grundsätzlich gilt: Ein qualifizierter Sachverständiger muss die verkürzte Nutzungsdauer bestätigen und diese muss, logischerweise, plausibel begründet werden. Die kürzere Restnutzungsdauer führt zu einer Erhöhung des jährlichen AfA-Satzes und damit zu einer Steigerung Ihres steuerlichen Abschreibungsvolumens.
• Die 15-Prozent-Grenze bei Renovierungen beachten: Das richtige Timing von Renovierungsarbeiten wirkt wie eine Stellschraube bei der Regulierung Ihrer Steuerlast. Planen Sie Renovierungen so, dass die Kosten in den ersten drei Jahren nach der Anschaffung unter dem Limit von 15 Prozent der Anschaffungskosten bleiben – dann können Sie sie sofort steuerlich absetzen. Überschreiten Sie die 15-Prozent-Marke müssen die Kosten auf die gesamte Abschreibungsdauer verteilt werden.
• Timing des Besitzübergangs: Ein oft übersehener Optimierungshebel ist der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten. Statt diesen an die Kaufpreiszahlung zu koppeln, können Sie im Kaufvertrag einen späteren Zeitpunkt festlegen. Dies verschafft Ihnen einen Zeitpuffer für Renovierungen, die dann noch nicht unter die 15-Prozent-Regelung fallen – und die als vorweggenommene Werbungskosten voll abzugsfähig sind.
• Folgende Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden, weil sie regelmäßig zu Streitigkeiten mit dem Finanzamt führen:
- eine unrealistische Kaufpreisaufteilung,
- fehlende Dokumentation von Kosten,
- undurchsichtige Inventarbewertung,
- falsche Behandlung/Zuordnung von Renovierungskosten.
Die rechtssichere Gestaltung einer optimalen und effektiven Abschreibungsstrategie ist kein Hexenwerk – sie verlangt gleichwohl eine umsichtige Planung und eine sorgfältige Dokumentation. Wenn Sie langfristig von greifbaren Steuervorteilen profitieren wollen, sollten Sie einen ausgewiesenen Experten mit der Materie betrauen.
FAQs
1. Was ist der Unterschied zwischen Altbau-AfA und Neubau-AfA?
Für vermietete Bestandsimmobilien gilt die lineare Abschreibung, bei der Häuser ab Baujahr 1925 50 Jahre lang jährlich mit 2 Prozent, beziehungsweise Gebäude, die vor 1925 errichtet wurden, 40 Jahre lang mit 2,5 Prozent per anno abgeschrieben werden dürfen. Für Neubauten ab 2023 können Eigentümer wahlweise linear 3 Prozent der Herstellungskosten über 33 Jahre abschreiben – oder sich, für Gebäude, die ab dem 1. Oktober 2023 fertiggestellt wurden, für die degressive AfA mit einen Startsatz von 5 Prozent entscheiden. In den Folgejahren wird der der Satz auf den jeweils abschreibungsfähigen Restwert der Immobilie angewandt. Ein späterer Wechsel zur linearen AfA ist möglich.
2. Was passiert, wenn der Abschreibungszeitraum abgelaufen ist?
Die Abschreibung für Immobilien endet mit dem Ablauf der Nutzungsdauer, danach kann der Eigentümer die AfA nicht mehr geltend machen. Verkauft er die Immobilie jedoch, so beginnt der Abschreibungszeitraum für den Käufer wieder von vorn und er kann die nächsten 33, 40 oder 50 Jahre von den steuerlichen Vorteilen profitieren.
3. Kann ich eine selbstgenutzte Immobilie abschreiben?
Ja, aber nur wenn es sich um eine Denkmalschutz-Immobilie oder ein Haus in einem ausgewiesenen, städtebaulichen Entwicklungs- und Sanierungsgebiet handelt. In diesen beiden Fällen dürfen Sie über 10 Jahre jeweils 9 Prozent der Sanierungskosten (nicht der Anschaffungskosten) steuermindernd geltend machen.
4. Richtet sich die Höhe der Abschreibung nach dem Kaufpreis?
Nein. Die Immobilien-AfA bezieht sich allein auf den Gebäudewert. Im Kaufpreis sind jedoch Gebäude und Grundstück enthalten, sie müssen folglich zunächst voneinander getrennt werden. Üblich, aber nicht von jedem Finanzamt so akzeptiert, ist eine Aufteilung von 80 Prozent für das Gebäude und 20 Prozent für den Grund und Boden.