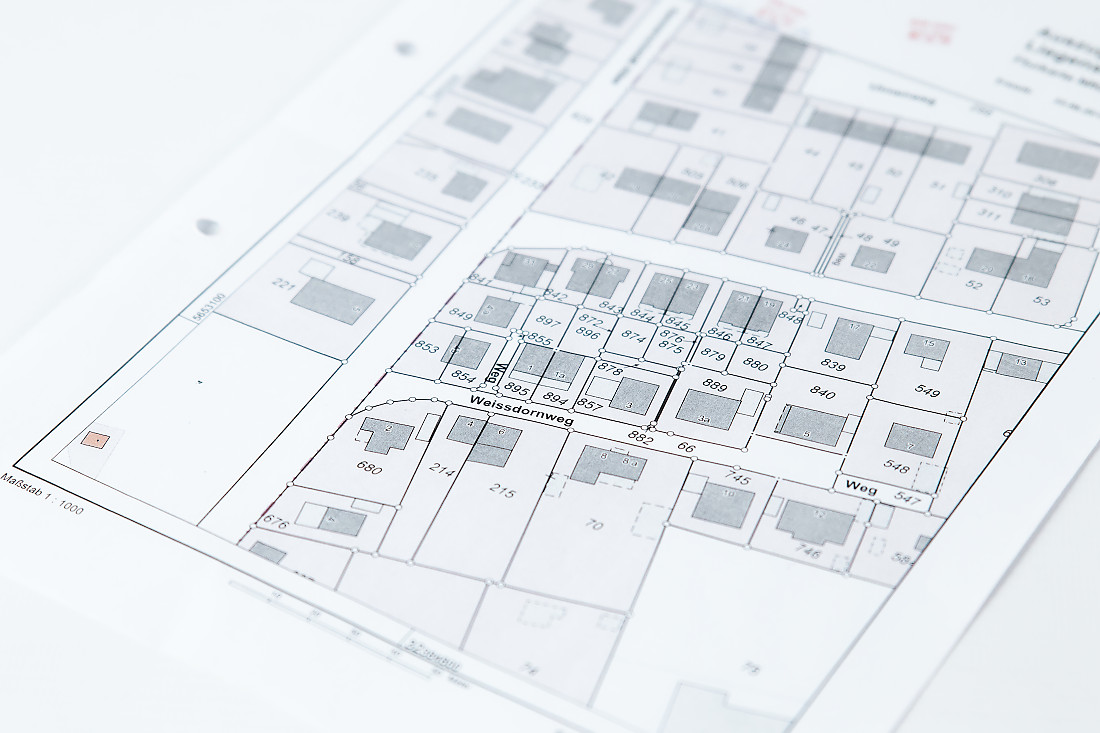Streitigkeiten rund um die Grundstücksgrenze füllen Jahr für Jahr Reihen von Aktenordnern an den Zivilgerichten oder bei den ihnen vorgelagerten Schlichtungsstellen. In der Mehrzahl der Fälle geht es dabei um Hecken, Sträucher, Bäume und sonstiges Gewächs des Nachbarn, das vermeintlich zu nah an der eigenen Grundstücksgrenze vor sich hin wuchert und dadurch stört. Daneben birgt vor allem die Grenzbebauung erhebliches Konfliktpotential. Wie nah dürfen Sie an Ihre Grundstücksgrenze bauen? Welche Abstandsflächen zum Nachbarn müssen Sie einhalten? Und gelten die gesetzlichen Regelungen grundsätzlich – also auch für den Carport, die Garage oder die Gartenlaube? Crux an der Sache: Es gibt keine bundeseinheitlichen Vorschriften, maßgeblich ist in erster Linie die Landesbauordnung Ihres Bundeslands. Daneben spielen die Regelungen des Nachbarschaftsrechts eine Rolle – und natürlich der jeweilige Bebauungsplan.
Lesen Sie im folgenden Ratgeber was Grenzbebauung genau meint, welche Abstandsflächen verbindlich sind, und in welchen Fällen Sie die Zustimmung Ihres Nachbarn benötigen. Hinweis: Alle folgenden Angaben beziehen sich auf Bayern.
Was genau bedeutet Grenzbebauung?
Schütteln Sie angesichts dieser scheinbar eindeutigen Frage nicht irritiert den Kopf: Natürlich handelt es sich um Grenzbebauung, wenn Sie mit Ihrem Bauvorhaben bis direkt an Ihre Grundstücksgrenze vorrücken. So weit, so logisch. Aber: Rein rechtlich ist der Tatbestand der Grenzbebauung auch dann erfüllt, wenn Ihr Bauprojekt lediglich den vorgeschriebenen Abstand zum Nachbargrundstück nicht einhält. Beispiel: Beträgt der vorgesehene Mindestabstand 3 Meter und Sie möchten bis auf 2,50 Meter an Ihre Grenze bauen, dann haben Sie es mit einem Fall von Grenzbebauung zu tun – obwohl Ihre Grundstücksmarkierung noch 2,50 Meter weit entfernt liegt.
Die Bestimmungen zur Grenzbebauung, respektive zu den Abstandsflächen, sind keine willkürliche Schikane, sondern resultieren ursprünglich aus den Erfordernissen eines effektiven Brandschutzes. Sie dienen gleichwohl dem Schutz der Privatsphäre jedes Eigentümers und garantieren ihm ein selbstbestimmtes und weitgehend störungsfreies Leben. Deshalb befassen sich auch gleich mehrere Gesetzestexte (mehr oder minder konkret) mit den Entfernungsrichtlinien für Gebäude auf unterschiedlichen Grundstücken:
• Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definiert in den §§ 903 bis 924 die grundsätzlichen Befugnisse eines Eigentümers, der zwar mit seinem Eigentum „nach Belieben verfahren“ darf, aber nur insoweit, als dass „Rechte Dritter“ dem nicht entgegenstehen.
• Das Baugesetzbuch (BauGB) fixiert allgemeine Anforderungen zu den Abstandsflächen und Baulinien.
• In der Landesbauordnung (LBO) werden die maßgeblichen Richtlinien für die Grenzbebauung und die konkret einzuhaltenden Entfernungen im jeweiligen Bundesland verbindlich festgelegt.
• Das jeweilige Nachbarschaftsrecht stützt sich zumeist auf die Vorgaben der Landesbauordnung, kann in Einzelfällen den zuständigen Baubehörden gleichwohl einen gewissen Entscheidungsspielraum zugestehen.
• Der Bebauungsplan regelt final auf kommunaler Ebene die konkrete Umsetzung der von der Landesbauordnung vorgegeben Richtlinien. Dabei gilt – und das ist recht wichtig: Der örtliche Bebauungsplan kann die gesetzlich definierten Abstandsflächen einer Grenzbebauung modifizieren oder gänzlich außer Kraft setzen. Sieht der B-Plan beispielsweise eine geschlossene Bebauung vor, dann können Sie nicht nur auf der Grundstücksgrenze bauen – Sie sind sogar dazu verpflichtet.
Wie viel Abstand zum Nachbarn muss sein?
Die genauen Vorgaben für die Entfernung bis zur Grundstücksgrenze legen, wie erwähnt, die jeweiligen Landesbauordnungen fest. Als grober Richtwert gilt deutschlandweit ein Abstand zwischen 2,5 und 3 Metern. Und auch der Weg, der zu dieser final verbindlichen Angabe führt, ist recht einheitlich:
• Die Abstandsfläche errechnet sich aus der Gebäudehöhe multipliziert mit einen bundeslandspezifischen Faktor zwischen 0,25 und 1 (der je nach Lage des Grundstücks variieren kann). In Bayern lautet dieser Faktor 1 für ländliche Regionen beziehungsweise 0,5 für Kerngebiete. Die Dachflächen werden je nach Neigungswinkel des Daches voll, nur zu einem Drittel oder nur zu einem Viertel zur Gebäudehöhe hinzugerechnet.
• Die festgelegte Distanz gilt grundsätzlich für die gesamte Breite der Fassade. Sie muss durchgängig eingehalten werden.
• Schreibt die LBO einen Mindestabstand von 3 Metern vor und liegt der errechnete Wert darunter, so müssen Sie trotzdem die 3 Meter einhalten. Liegt das Ergebnis hingegen darüber, so gilt verbindlich die höhere Zahl.
Beispielrechnung für ein 5,2 Meter hohes Haus in einem bayerischen Nicht-Kerngebiet, also mit Faktor 1: 5,2 m x 1 = 5,2 m. Das Dach ist 2,40 m hoch und wird zu einem Drittel gerechnet, also mit 80 Zentimetern. Es ergibt sich eine Gesamtabstandsfläche von 5,2 m + 0,8 m = 6,0 m.
Wann ist eine Grenzbebauung erlaubt?
Von den strikten Regeln einer klassischen Grenzbebauung sind in den allermeisten Bundesländern einige „Bauwerke“ ausgenommen:
• Für Garage oder Carport sind die jeweiligen Distanzregeln irrelevant. Sie dürfen bis an die Grundstücksgrenze gebaut werden – vorausgesetzt, sie sind nicht höher als 3 Meter und nicht länger als maximal 9 Meter.
• Für Gartenlauben und Gewächshäuser gelten analog dieselben Regeln.
• Als Eigentümer können Sie selbst darüber bestimmen, ob und wie Sie Ihr Grundstück einfrieden oder einzäunen.Ob Sie also zum Beispiel eine Bruchsteinmauer errichten oder einen Gartenzaun aus Holz, bleibt Ihnen überlassen. In Bayern dürfen Sie bis zu 1,50 Meter Höhe genehmigungsfrei bauen – allerdings zumeist mit 50 Zentimeter Abstand zur Grundstücksgrenze. Für Zäune und Mauern, die höher sind, müssen Sie eine Baugenehmigung einholen.
Gut zu wissen: Auch für Hecken, Bäume und Sträucher an der Grundstücksgrenze gelten festgelegte Mindestabstände – sie richten sich nach der Höhe der Pflanze: Ist sie (oder wird sie) bis zu 2 Meter hoch, so müssen Sie einen Abstand von 50 Zentimetern bis zur Grundstücksgrenze einhalten. Bei Pflanzen, die höher als 2 Meter sind (oder werden) sind es 2 Meter. Verstoßen Sie gegen diese Abstandsvorschriften, so kann Ihr Nachbar die „Herstellung eines vorschriftsmäßigen Abstands verlangen“. Meint ganz praktisch: Hecke oder Baum müssen wahlweise entfernt oder gestutzt werden.
Bitte beachten Sie: Wärmepumpen werden von Eigentümern gern direkt an der Grundstücksgrenze aufgestellt, weil sie dann nicht gesehen und nicht gehört werden. Allerdings sind sich die Gerichte noch weitgehend uneins, ob Wärmepumpen die in den Bauordnungen der Länder für Gebäude vorgesehenen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten müssen oder nicht. Erkundigen Sie sich deshalb sicherheitshalber bei Ihrer zuständigen Baubehörde, welche Regelung bei Ihnen vor Ort gilt.
Heikle „Grenzfälle“: Immer wieder müssen sich Gerichte mit gelegentlich recht sonderbaren nachbarschaftlichen Streitigkeiten um vermeintlich unerlaubte „Grenzbebauungen“ befassen. So hat beispielsweise eine Anekdote aus Rheinland-Pfalz für (öffentliches) Aufsehen gesorgt. Ein Eigentümer sah sich durch einen knapp zwei Meter hohen Brennholzstapel gestört, den sein Nachbar an der Grundstückgrenze aufgetürmt hatte. Er zog vor das zuständige Amtsgericht – das zu seinen Ungunsten entschied, obwohl die Landesbauordnung einen Abstand von 3 Metern vorsieht. Allein: Der Brennholzstapel war nicht hoch genug, um diese Vorschrift anwenden zu können. Auch die nächsthöhere Instanz bekräftigte das Urteil und wies explizit daraufhin, dass auch die Länge des Holzstapels von 8 Metern und seine Breite von 40 Zentimetern an diesem Umstand nichts ändere.
In welchen Fällen ist die Zustimmung des Nachbarn nötig?
Immer dann, wenn Sie die vorgeschriebenen Abstandsflächen unterschreiten möchten, benötigen Sie dafür nicht nur die Zustimmung der Baubehörde, sondern auch die des betroffenen Nachbarn – der diese selbstredend verweigern kann, wenn er sich in seiner Privatsphäre beeinträchtigt fühlt. Erkundigen Sie sich am besten zunächst bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob Sie Ihrem Bauantrag mit Abstandsflächenbefreiung diese schriftlich fixierte Zustimmung des Nachbarn direkt beifügen müssen – oder ob die Baubehörde den Eigentümer des Nachbargrundstücks im Laufe des Verfahrens selbst kontaktiert. Wichtig: Die Einverständniserklärung muss im Grundbuch fixiert werden, um rechtlich verbindlich zu sein. Widerspricht der Nachbar Ihren Plänen, so bekommen Sie Ihr Vorhaben nicht genehmigt.
Alternativ besteht die Möglichkeit, mit Ihrem Nachbarn eine Baulast zu vereinbaren. In diesem Fall stellt der Nachbar die fehlende Abstandsfläche auf seinem Grundstück zur Verfügung, wenn diese auf Ihrem Grundstück nicht ausreicht. Die Belastung des Nachbargrundstücks mit einer solchen Abstandsbaulast mindert gleichwohl dessen Wert – und für gewöhnlich müssen Sie Ihrem Nachbar dafür eine Entschädigungssumme zahlen.
Beispiel: Unterstellt die Abstandsfläche für Ihr Bauvorhaben muss 3 Meter bis zum nächsten Gebäude betragen. Das heißt, Ihr Haus muss 1,50 Meter vom Nachbargrundstück entfernt sein und das nächste Gebäude auf dem Nachbargrundstück muss ebenfalls einen Abstand von 1,50 Meter zur Grenze einhalten. Planen Sie nun, bis auf einen halben Meter an die Grenze heranzubauen, so klappt das nur, wenn Ihr Nachbar dem zustimmt und gleichzeitig einen Mindestabstand von 2,50 Meter einhält, um Ihr Heranrücken auszugleichen.
Tipp: Sprechen Sie auch in einem solchen Fall sicherheitshalber zuvor mit der zuständigen Baubehörde, um abzuklären, ob nicht andere Umstände à priori gegen Ihre Baumaßnahme sprechen.
Welche Strafen drohen bei unerlaubter Grenzbebauung?
Eine widerrechtliche Grenzbebauung liegt immer dann vor, wenn
• Sie ohne die erforderliche Zustimmung des Nachbarn den Mindestabstand zum Nachbargrundstück unterschreiten,
• keine Baugenehmigung eingeholt haben, obwohl Sie ein genehmigungspflichtiges Vorhaben umsetzen,
• Sie die Baugenehmigung oder den örtlich geltenden Bebauungsplan bei der Ausführung missachten.
In all diesen Situationen können sowohl der Nachbar als auch die Gemeinde rechtliche Schritte gegen das Vorhaben einleiten: Als Bauherr müssen Sie mit Geldstrafen, Stilllegung, im schlimmsten Fall mit angeordneten Rückbaurechnen. Wichtig: Nach den Buchstaben des Gesetzes verjährt das „Unrecht“ einer unerlaubten Grenzbebauung nie. In der Praxis hat sich gleichwohl stillschweigend eine Verjährungsfrist von 3 Jahren für Privatpersonen etabliert, das meint: für zivilrechtliche Klagen gegen den Bauherrn. Im öffentlichen Recht gilt dieses Zugeständnis jedoch nicht. Falls eine Gemeinde also nachträglich eine widerrechtliche Grenzbebauung feststellt, kann Sie den Bauherrn auch nach vielen Jahren noch rechtlich für den Schwarzbau belangen.
Die konkreten juristischen Optionen orientieren sich nichtsdestotrotz immer an den Details des Einzelfalls. Unter Anwälten kursiert eine hübsche Anekdote: Kann der Neueigentümer eines Grundstücks von der Baubehörde die Beseitigung eines illegalen Schwarzbaus an der Grenze des Nachbargrundstücks einfordern, wenn dieser Schwarzbau ein halbes Jahrhundert niemanden gestört hat? Fragen Sie drei Juristen und Sie erhalten vermutlich vier Antworten.
• Was bedeutet Bestandsschutz?
Ob Sie eine Grenzbebauung möglicherweise wieder abreißen müssen, bemisst sich auch an den konkreten Regeln des sogenannten Bestandsschutzes. Dieser schützt bereits erbaute Gebäude auch dann, wenn die Anlage in dieser Nutzungsform durch zwischenzeitlich erfolgte rechtliche Änderungen heute so nicht mehr gebaut werden dürfte. Der Bestandsschutz greift bevorzugt für Gebäude, die unter Beachtung der damaligen Gesetze an der Grenze gebaut wurden – allerdings kann eine Gemeinde im Einzelfall auch festlegen, dass ein eigentlicher Schwarzbau von annodazumal nun rechtmäßig ist und für ihn daher Bestandsschutz gilt. Immer jedoch ist der Bestandsschutz direkt an die Nutzungsart gekoppelt.
Dazu ein beliebtes Beispiel: Ein Landwirt hat vor Jahrzehnten ein großes Hühnerhaus an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet. Dies dürfte er heute aufgrund der geänderten lokalen rechtlichen Regelungen nicht mehr. Der Landwirt hat die Hühnerhaltung inzwischen aufgegeben und baut nun Spargel an. Die zur Ernte engagierten Saisonarbeiter möchte er im ehemaligen Hühnerhaus unterbringen, das dazu entsprechend umgebaut werden soll. Durch die Umbaumaßnahmen und die Nutzungsänderung verfällt jedoch der Bestandsschutz – der Landwirt benötigt eine neue Genehmigung und die Zustimmung des Nachbarn.
Fazit: Stimmen Sie eine Grenzbebauung immer mit Ihrem Nachbarn ab
Die Vorschriften in den Landesbauordnungen und die Vorgaben des lokalen Bebauungsplan zu den Mindestabständen zur Grundstücksgrenze dienen dem Schutz der Privatsphäre eines jeden Eigentümers. Bundesweit betragen sie grundsätzlich zwischen 2,5 und 3 Meter. Von diesen Vorschriften ausgenommen sind Garage, Carport und Gartenlaube, mit denen Sie auch näher an Ihre Grenze vorrücken dürfen. Sprechen Sie trotzdem vor dem Bau mit Ihrem Nachbarn über das geplante Vorhaben, um Missmut und Verstimmungen im Verhältnis zu vermeiden. DasPrinzip gegenseitiger Rücksichtnahme – das im Übrigen in allen Nachbarschaftsgesetzen als eherner Grundsatz fixiert ist – hilft im Alltag ganz praktisch, das Nebeneinander-Wohnen harmonisch und freundschaftlich zu gestalten.
FAQs
1. Welche Art von Grenzbebauung muss der Nachbar dulden?
Für einen Carport, eine Garage oder eine Gartenlaube benötigen Sie keine Nachbarzustimmung, auch wenn Sie diese Gebäude direkt an Ihrer Grundstücksgrenze errichten. Beachten Sie jedoch, dass Sie eine Gebäudehöhe von 3 Metern nicht überschreiten und die Länge nicht über 9 Metern liegt.
2. Wann ist eine Grenzbebauung widerrechtlich?
Unterschreiten Sie den Mindestabstand zum Nachbargrundstück und dies ohne (die formal nötige) Zustimmung des Nachbarn, so ist Ihre Grenzbebauung illegal. Das Gleiche gilt selbstverständlich, wenn Sie gegen die Vorgaben des Bebauungsplans verstoßen oder anders bauen als die Baugenehmigung es Ihnen erlaubt.
3. Verjährt eine widerrechtliche Grenzbebauung?
Nein. Eine widerrechtliche Grenzbebauung verjährt nie. Haben Sie oder Ihr Nachbar die erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehalten, obwohl hierfür die Zustimmung des Nachbarn und/oder eine Baugenehmigung erforderlich gewesen wäre, können Gemeinde und Nachbar prinzipiell jederzeit auf Abriss/Rückbau klagen.
4. Gibt es Grundstücke, auf denen keine Abstandsflächen gelten?
Ja. Sieht der Bebauungsplan beispielsweise eine Reihenhaussiedlung vor, so ergibt sich aus der Natur der Sache, dass die ansonsten üblichen Abstandsflächen entfallen. Das gleiche gilt analog für Doppelhaushälften.